Olga Hohmann
Am Ende war das Wort
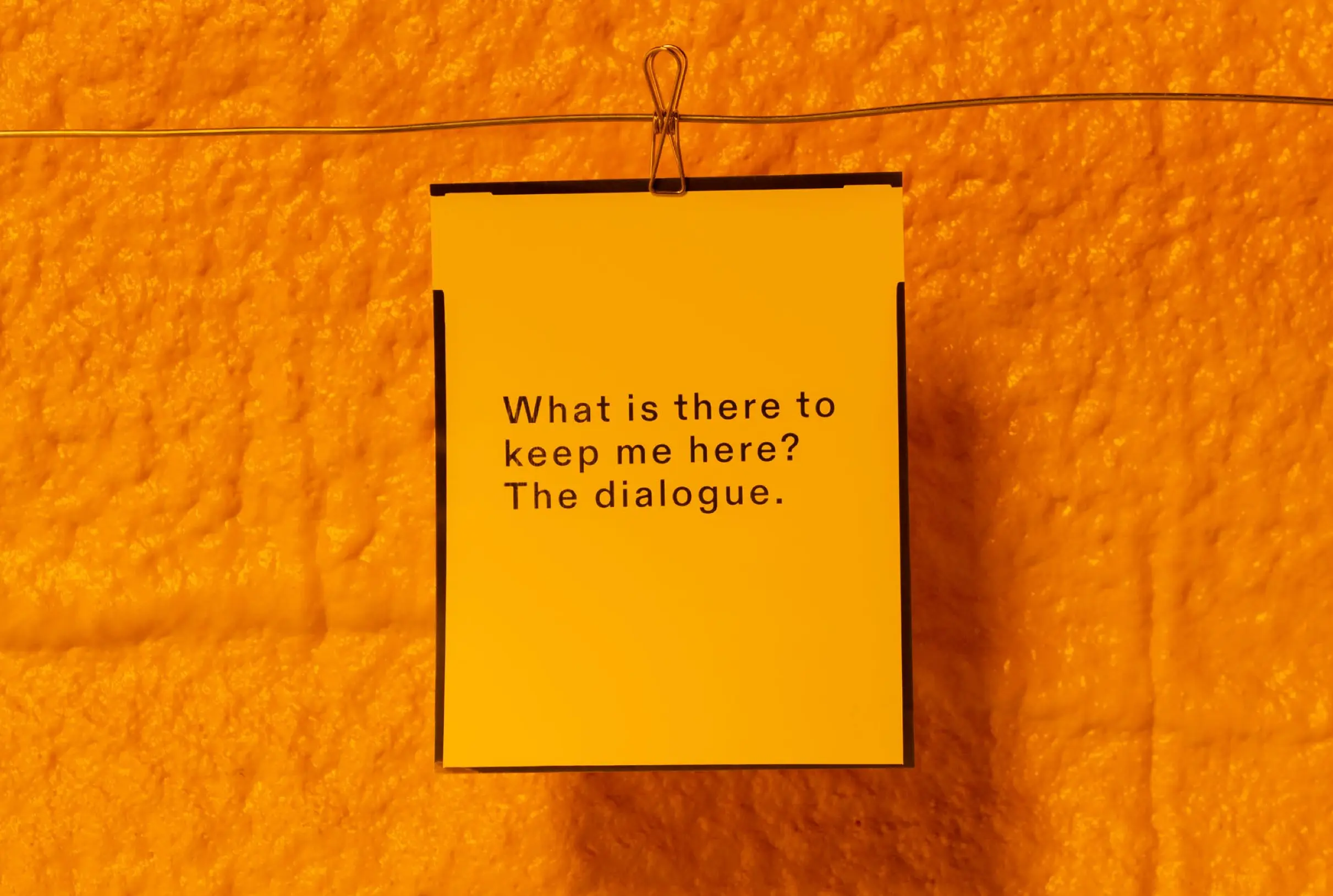
Max Eulitz und Leonie Schmieses zweiteilige Ausstellung „Fin de Partie“ (Louche Ops, Berlin) und „First Generation“ (Chatham Soccer, Upstate New York)
Wie klingt Sprache, wenn die Worte ihre Relevanz einbüßen? Das fragt sich Samuel Beckett in seinem „Endspiel“ (1956) – und später dann nochmal Theodor W. Adorno, in dem (verzweifelten) „Versuch das Endspiel zu Verstehen“ (1973). Der Relevanzverlust der Sprache (fast nicht mehr lustig) scheint die Reaktion auf ein historisches Ereignis zu sein, das die Welt in ein Vorher und ein Nachher teilt. Die Subjektivität der Protagonist:innen, das heißt, die Eigenschaft, dramatische „Characters“ zu sein, die daran glauben, dass ihre Worte und Taten eine Bedeutung oder Wirkung haben, ist bei Beckett verschwunden – das Post-Dramatische ist ein politischer Zustand, nicht nur ein formales Phänomen. Clov, Hamm, Nagg und Nell taumeln wie indifferente, tumbe Marionetten ohnmächtig durch das Welttheater, das keine Lust mehr hat, zu spielen, das heißt, an ihren Fäden zu ziehen. Sie sind Schlafwandelnde in einem Raum, von dem man nicht weiß, ob er zu groß oder zu klein ist. In diesem Setting gibt es keine unversehrten Subjekte, nur noch kaputte Proxies am Ende der Geschichte. Ohne Klimax, ohne Entwicklung, bleiben sie auch nach dem letzten Akt noch auf der Bühne zurück. Haben sie uns dennoch etwas zu sagen? Was ist der ungeklärte Rest (Hoffnung) am Abgrund des Bühnenrandes, woher kommt der Antrieb der Vergessenen, doch immer wieder ihre Stimme zu erheben?

Max Eulitz und Leonie Schmiese wiederholen und hinterfragen das Beckett’sche Szenario und überführen es von der Sphäre des Theaters in die Bildende Kunst – in zwei zusammenhängenden, sich aber radikal unterscheidenden Ansätzen.
In „Fin de Partie“ am Berliner Victoria Luise Platz sehen wir, im Berliner Zimmer eines Gründerzeitbaus, schwarz-weiß Portraitfotografien. Es sind Schaufensterpuppen, Normwesen aus der Vergangenheit, deren eindrückliche Gesichter durch fragmentierte und neu-arrangierte Zitate aus dem Originalstück von Beckett ergänzt werden:
B: We’re not beginning to, to, mean something?
A: Mean something! Ah, that’s a good one.
B: Time for love?
A: If I could sleep, I might make love.

Reminiszenzen aus dem erschöpften Bürgerlichen Trauerspiel, getragen von lakonischem Witz. Es wirkt so, als würden die Protagonist:innen, die eigene Unbeholfenheit affirmierend, nur eine Freude am Leben haben: Die Lust an der Absurdität des Moments.
Im Hintergrund zischen und rotieren die beweglichen Teile von Dampfmaschinen en miniature, verrichten eine vergebliche Arbeit ohne erkennbaren Zweck, reichern die Luft an mit Wasserdampf und Spiritus. Kleine Flammen schlagen über den Sockel. Kein Stillstand, sondern Bewegung. Zumindest die menschengemachten Apparaturen geben nicht auf. Symbole des industriellen Fortschritts, reduziert auf Hobbykeller-Größe, eine doppelte Untermalung der menschlichen Autorität, des Blicken von oben (herab). Betrachtet Beckett seine Charaktere auf Augenhöhe? Das Bühnenbild im Ausstellungsraum wird ergänzt durch landwirtschaftliche Gerätschaften, vorindustrielle Boten der Mensch-Maschine-Beziehung, deren sandgestrahlten Oberflächen jede auratische Aufladung von sich weisen. Die Mannequins starren uns an und lassen uns unserer eigenen Position als bloße Betrachter:innen gewahr werden, der Performativität der sozialen Situation „Ausstellungseröffnung“. Es ist eine Illusion, dass wir nur betrachten – zumindest befinden wir uns selbst, so sagen die ahnenden/mahnenden Blicke der Puppen, in the midst of trouble. Schlafwandeln wir ebenso wie Hamm, Clov, Nagg und Nell?
Während also dieser erste Teil der Ausstellung in Berlin scheinbar rät, dem unausweichlichen Ende mit erschrecktem Humor zu begegnen, hat der zweite der Teil, betitelt “Last Generation” und situiert in einer verlassenen Papierfabrik in Upstate-New York, eine andere (fehlende) Pointe:

Hier sind es die, ebenfalls mit einer analogen Großformatkamera im Direkt-Positiv-Verfahren abgelichteten, Gesichter von Babypuppen, die, um die Dampfmaschinen herum positioniert, sich mit dem Ende der Geschichte nicht zufrieden geben wollen. Ihre surreale Korrespondenz, diesmal nur noch lose auf Beckett aufbauend, scheint anzudeuten, dass es gelingen könnte ein Herr-der-Fliegen-Szenario zu vermeiden. Der Macht von DaDa sei dank, wäre dann die “Last Generation” plötzlich “The First Generation”. Als ob die Würfel nur immer wieder fallen müssten, damit schließlich der Mensch dem Menschen kein Wolf mehr ist.

Ein positiver Ausblick, wenn man so will, auch wenn der Abstieg in den feuchten Keller der postindustriellen Ruine am Ufer des Hudson River zunächst wenig Hoffnung machte. Max Eulitz und Leonie Schmieses Versuch, das Beckettsche Narrativ in Form zweier Austellungen weiterspinnen wirft die Frage auf, was bleibt in einer Welt, die sich mit jedem Tag schneller dreht und doch still zu stehen scheint. Die Dampfmaschinen blasen ihren Wasserdampf in die Fabrik, die keine mehr ist – sie kochen, wie wir, mit Wasser.
Das ernüchtert-pathetische gestammelte Fazit einer Beckett-Figur:
A: What is there to keep me here? The dialogue.
(as if)